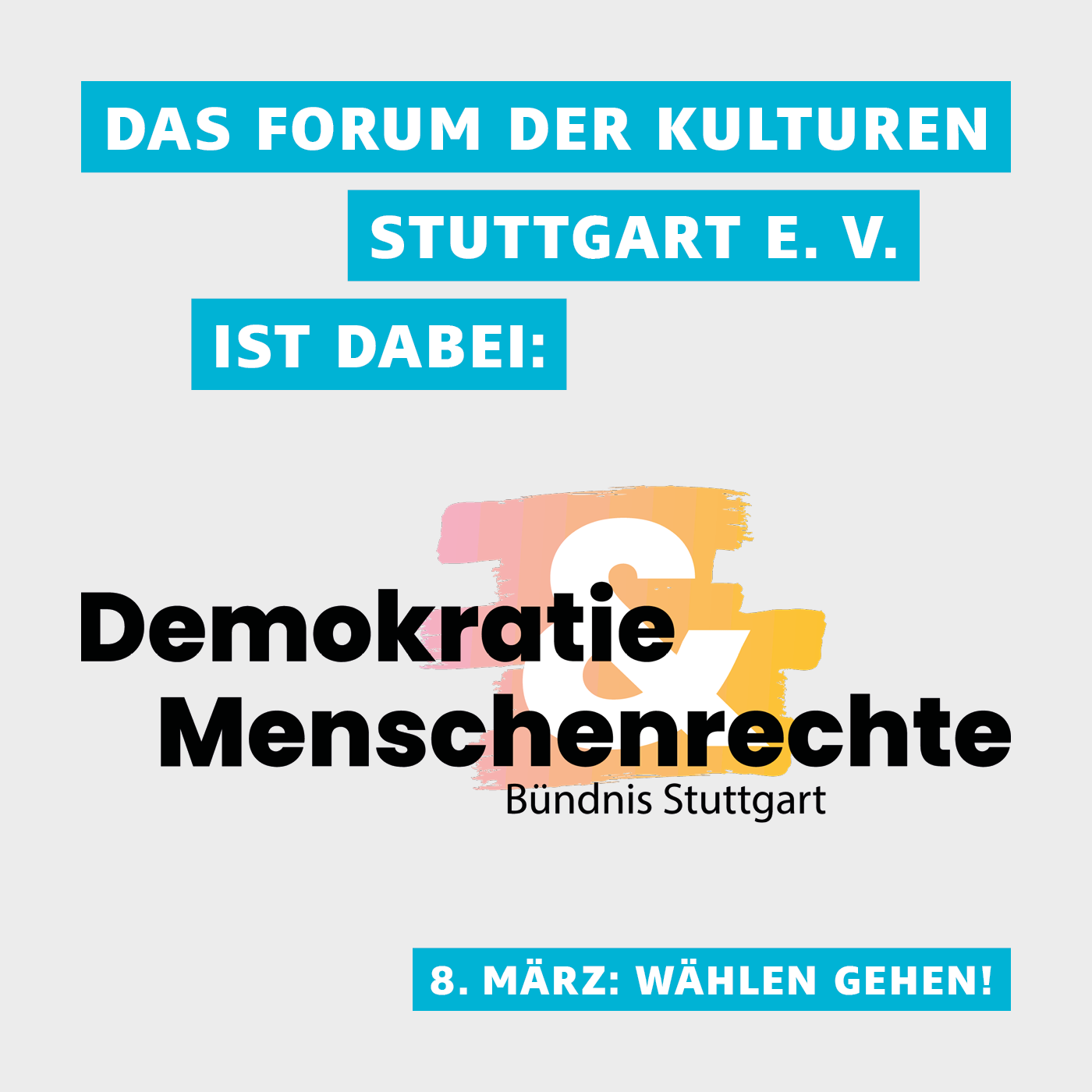Souleymans Geschichte
Originaltitel: L’Histoire de Souleymane Frankreich 2024
93 Minuten
Regie und Drehbuch: Boris Lojkine
Mit: Abou Sangaré, Nina Meurisse, Alpha Oumar Sow
Start: 19. Februar 2026
Verleih: Film Kino Text
Hoffnungsreiches Abstrampeln
Souleyman stammt aus Guinea, er könnte aber auch aus einem anderen afrikanischen Land – aus einem Krisengebiet im Nahen Osten, Südamerikas oder Osteuropas – stammen. Die Gründe, warum Souleyman in Paris auf eine neue Existenz hofft, spielen nicht wirklich eine Rolle. Entscheidend ist, mit welchem Narrativ es ihm gelingen könnte, die Asylbehörde in Paris zu überzeugen, ihm einen Aufenthaltstitel zu verleihen. Denn ohne diesen ist Souleyman ein Illegaler in Frankreich, dürfte offiziell also nicht arbeiten.
Genau diese Situation machen sich andere zunutze. Seinen Job als Foodkurier hat Souleyman nur, weil ein anderer ihm seinen Account geliehen, besser: gegen Gebühr verkauft hat. Vom sauer verdienten Geld muss Souleyman also schon mal einen entscheidenden Teil abzwacken. Ein anderer Teil geht drauf für ein Coaching, das ihm beim Einstudieren seiner Geflüchtetenstory helfen soll. Weil der Mitte 20-Jährige Afrikaner aber eine grundehrliche Haut ist, fällt es ihm nicht leicht, sich hinter einer ausgedachten Geschichte zu verstecken.
Regisseur Boris Lojkine hat diesen im wuseligen Paris spielenden Film im Stil eines semidokumentarischen Cinéma Vérité gedreht. Mit der Kamera folgt er seinem gehetzten Protagonisten durch seinen Alltag. Und ein bisschen schaut er ihm dabei auch in die Seele, deutlich spürt man seine Angst und Unsicherheit, am Ende abgeschoben zu werden.
Bis spät in die Nacht tritt Souleyman bei seinem prekären Job in die Pedale und hofft im Anschluss auf eine ruhige und erholsame Nacht in einer Asylunterkunft vor den Toren der Stadt, sofern ihm der letzte Bus nicht vor der Nase weggefahren ist. Vor allem aber hofft er darauf, sich selbst nicht zu verlieren in diesem Leben, das ihm täglich die Grenzen seiner Existenz vor Augen führt und in dem es Rückgrat braucht, sich selbst gegenüber ehrlich zu bleiben. Nicht von ungefähr ist Darsteller Abou Sangaré für seine Rolle verschiedentlich mit Preisen ausgezeichnet worden.

Ein Kuchen für den Präsidenten
Originaltitel: Mamlaket al-qasab
Irak/USA/Katar 2025
105 Minuten
Regie und Drehbuch: Hasan Hadi
Mit: Baneen Ahmed Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat, Rahim AlHaj u.v.a.
Start: 5. Februar 2026
Verleih: Vuelta Germany
Zutatensuche in Zeiten von Lebensmittelknappheit
Im Spielfilm Ein Kuchen für den Präsidenten des Irakers Hasan Hadi ist der Präsident Saddam Hussein, dem die Schülerschar vor Unterrichtsbeginn lautstark und inbrünstig schwört, ihm Blut und Seele opfern zu wollen. Das Problem für Lamia aber ist: die Lebensmittel im Irak im Jahr der Filmhandlung, 1997, sind aufgrund eines international verhängten Embargos knapp. Die Suche nach Zutaten gerät für das Mädchen, ihren gleichaltrigen Begleiter Said und einen unterm Arm transportierten Hahn zu einem Abenteuer fast schon märchenhaften Ausmaßes.
Der damalige Golfkrieg ist für die Menschen im Film allgegenwärtig. Die Bedrohung gehört zum Alltag. Sie macht die Menschen, in Verbindung mit Armut, Leid und Misstrauen aber auch aggressiv. Und selbst jenen, die Hilfsbereitschaft andeuten, ist nicht unbedingt über den Weg zu trauen. Patriarchale Strukturen tun ein Übriges. Nicht die besten Voraussetzungen für die unbeschwerte Kindheit eines Mädchens also. Groß ist der Schock deshalb für Lamia, als sie bei einer Tagesfahrt mit der Großmutter in die Hauptstadt mitbekommt, dass sie dort offenbar zu einer Pflegefamilie kommen soll, weil die Großmutter bereits spürt, wie ihr die Lebenskräfte schwinden.
Obgleich Krieg, Bedrohung und gesellschaftliche wie politische Stimmungen so deutlich spürbar sind, lockern situationskomische Szenen die Abfolge bedrückender Szenen immer wieder auf. Ein Taxifahrer steht symbolisch für jene ein, die das Herz doch noch am rechten Fleck tragen. Nicht zuletzt dieser Mischung aus Witz und Warmherzigkeit wegen hat Hasan Hadi dafür 2025 in Cannes die Goldene Kamera als bestes Spielfilmdebüt erhalten.

No Other Choice
Originaltitel: Eojjeolsuga eobsda
Südkorea 2025
139 Minuten
Regie und Drehbuch: Park Chan-wook
Mit: Lee Byung-hun, Son Yejin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran
Start: 5. Februar 2026
Verleih: Plaion Pictures
Grüner Daumen, blutige Gedanken
Der Film basiert auf einem Kriminalroman von Donald Westlake. Weil die Welt sich in den vergangenen 20 bis 30 Jahren seit dessen Erscheinen weitergedreht hat, hat die satirische Komödie aus Südkorea einige neue Wendungen erfahren. Wie geht es einer ausgesucht gutsituierten Upper-Class-Familie, wenn ihr der soziale Abstieg und damit ein Gesichtsverlust droht? Dass die amerikanische Entlassungsformel „you’re fired“ im Koreanischen mit „Kopf ab“ umschrieben wird, sagt da bereits einiges. Und auch die Reaktion des Teenagersohnes auf die Ankündigung, dass man nun wohl auf das Netflix-Abo verzichten müsse, spricht Bände.
25 Jahre lang hat Familienoberhaupt und Mittelschichtskarrierist Man-su sich und seiner kleinen Familie ein perfektes Leben erschaffen. In der Eingangsszene sieht man ihn im Garten seines schicken Hauses beim Aalgrillen. Der sich blätterbunt ankündigende Herbst wirkt hier noch idyllisch, steht zugleich aber auch schon für das Vergängliche, für Jobverlust, Verzicht auf Wohlstandsinsignien – und für den Tod.
In seiner Verzweiflung sieht Man-su nur einen Ausweg: er muss Mitbewerber*innen um die wenigen Jobs, die es im Zeitalter von KI in seiner Branche noch gibt, aus dem Weg räumen. Er tut dies als einer, der eben kein kaltblütiger Killer ist – und genau dies führt in Verbindung mit einem schmerzenden Backenzahn und dem grünen Daumen des Hobby-Bonsaiologen zu kreativen bis irrwitzigen Slapstickmomenten. Inszeniert ist all dies mit besonderer Akkuratesse, die erneut von der Meisterschaft Park Chan-wooks kündet. Auch wenn’s manchmal wehtut: Vergnügen bereitet diese Komödie absolut.

Ein einfacher Unfall
Iran/Frankreich/Luxemburg 2025 Originaltitel: Yek tasadef sadeh/It was just an accident
107 Minuten
Regie: Jafar Panahi
Mit: Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi u. a.
Start: 8. Januar 2026
Sie nannten ihn Gießkanne
Der Grund für die Entführung des Familienvaters ist eine impulsive spontane Aktion. Der Automechaniker Vahid ist überzeugt, aufgrund eines von einer Beinprothese herrührenden Gehgeräusches seinen ehemaligen Peiniger vor sich zu haben. „Gießkanne“, so heißt es, hätten sie ihn genannt. Ganz sicher ist sich Vahid aber nicht, weshalb er verschiedene andere ehemalige regime-kritische Mitgefangene kontaktiert, die die Identität des Entführten bestätigen sollen. Sie repräsentieren dabei die vielen, mehr oder weniger fest organisierten Oppositionsgruppen. Während die einen der Meinung sind, dass man nicht mit Gewalt auf einst geschehenes Leid reagieren sollte, ist Rache für andere die einzige Antwort.
Panahi mischt diesem sehr ernsten und emotionalen, an ein moralisch-ethisches Gewissen appellierenden Konflikt immer wieder auch absurd-komische Momente bei, verdeutlicht so die unterschiedlichen Haltungen bezüglich erlittener Traumata und gelebter Menschlichkeit. Und er macht deutlich, dass egal welche Entscheidung schließlich getroffen wird, ein Trauma nicht durch eine andere Untat zum Verschwinden gebracht werden kann.
Der iranische Regisseur und Autorenfilmer Jafar Panahi ist bekannt dafür, sich kritisch mit Politik und Gesellschaft in der Islamischen Republik auseinanderzusetzen. In seinem Heimatland wurde er deswegen wiederholt inhaftiert und mit einem Berufsverbot belegt. Die Erfahrungen, die er infolge dieser einschneidenden Umstände gemacht hat, kommen in diesem Film zum Ausdruck. Frankreich schickt den zweifachen Palmen-Gewinner von Cannes mit Ein einfacher Unfall ins anstehende Oscar-Rennen um den besten internationalen Spielfilm.

Dreamers
Großbritannien 2025.
78 Minuten.
Regie: Joy Gharoro-Akpojotor
Mit: Ronke Adekoluejo, Ann Akinjirin, Diana Yekinni, Aiysha Hart, Harriet Webb
Start: 11. Dezember 2025
Loslassen, um hereinzulassen
In Hatchworth landen Frauen, die illegal nach Großbritannien eingewandert sind und nun auf ein Bleiberecht hoffen. Vor allem Afrikanerinnen und Immigrantinnen aus dem Nahen Osten teilen sich die immerhin halbwegs wohnlich ausgestatteten Zimmer. Auch wenn es teilweise zugeht wie in einem von Mauern und Stacheldraht umzäunten Gefängnis mit Hofgang und sogar Bandenkriminalität, scheint es keine Bedenken zu geben, wenn die Insassinnen beim Küchendienst mit Messern hantieren dürfen.
Die wie die Regisseurin aus Nigeria stammende Politikwissenschaftlerin Isio wird dem Zimmer der Muslimin Farah zugeteilt – und von ihr angeleitet, wie ein Alltag zu meistern sei, der von der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit und der gleichzeitigen Angst, abgeschoben zu werden, bestimmt wird. „Die Freiheit beginnt im Kopf“, macht Farah immer wieder deutlich. Ihre weiteren Worte vom „loslassen, um hereinzulassen“ beziehen sich dann bereits auf die zwischen den beiden Frauen aufkeimende Zuneigung und Liebe zueinander. Von einer gemeinsamen Zukunft zu träumen, so ungewiss sie ist, gibt beiden Kraft – auch, um gegen die inneren Dämonen, Traumata und Frustrationen anzukämpfen und sich ihnen zu stellen. Die Farbenfreude, mit der der Film ausgestattet ist, illustriert dieses Ansinnen.

Die jüngste Tochter
Frankreich/Deutschland 2025
Originaltitel: La petite dernière
107 Minuten
Regie: Hafsia Herzi
Mit: Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed, Melissa Guers, Rita Benmannan u. a.
Start: 25. Dezember 2025
Zwei Herzen in einer Brust
Dass ein Junge aus ihrer muslimischen Community ihr quasi einen Heiratsantrag macht, sie perspektivisch damit konfrontiert, als Mutter an den Herd zu verschwinden und sie auffordert, sich weiblicher zu kleiden, gefällt ihr nicht. Über Dating-Apps, in denen sie sich mit einem anderen Namen ausgibt, lernt sie Frauen kennen, die ihr homosexuelles Coming-Out bereits hinter sich haben. Und auch wenn Fatima spürt, dass sie sich in ihrer neuen Rolle als queere junge Frau frei fühlt – der innerliche Konflikt zu ihrem religiösen Glauben bleibt bestehen.
Die französische Drehbuchautorin und Regisseurin Hafsia Herzi, bekannt geworden durch ihre Rolle in Abdellatif Kechiches Couscous mit Fisch (2007), hat den autofiktionalen Debütroman von Fatima Daas aus dem Jahr 2020 adaptiert. „Aus eigener Erfahrung als ‚Mädchen aus der Sozialbausiedlung‘, das in den nördlichen Stadtvierteln von Marseille aufgewachsen ist, kenne ich Charaktere wie den von Fatima und weiß, dass es nicht leicht ist, anders zu sein – und dazu zu stehen. Doch diese Geschichte lässt sich nicht auf einen sozialen Typus reduzieren. Sie ist völlig universell“, sagt Herzi, die selbst als jüngste Tochter in einer französisch-tunesischen Familie aufgewachsen ist. Entsprechend wahrhaftig und emotional begleitet ihr Film das sexuelle Erwachsenwerden von Fatima und ihre Suche nach einem Platz in einer für sie zwischen Tradition und Aufbruch stehenden Welt.
Dass die Hauptdarstellerin Nadia Melliti, 2002 in Paris geboren, in ihrem Schauspieldebüt versiert ist im Umgang mit einem Fußball, kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich wollte sie Profifußballerin werden. Mit ihr entdeckt man ein faszinierendes Gesicht auf der Leinwand, erblickt darin sowohl Stärke und Entschlossenheit wie auch Einsamkeit und Verlorensein – und spürt nachvollziehbar, wie in der Brust von Fatima zwei Herzen schlagen.

Im Schatten des Orangenbaums
Deutschland, Zypern, Palästina, Jordanien, Griechenland, Katar, Saudi Arabien 2025 Originaltitel: All that’s left of you
145 Minuten.
Regie: Cherien Dabis.
Mit: Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Maria Zreik, Mohammad Bakri u. a.
Start: 20. November 2025
Geschichte eines kollektiven Leidens
In einer langen Rückblende begibt sich der kürzlich in Stuttgart als Eröffnungsfilm des Arabischen Filmfestivals in Anwesenheit der Regisseurin gezeigte Film zunächst ins Jahr 1948 nach Jaffa, wo man im Zuge der Gründung des neuen Staates Israel Zeuge der Enteignung einer Familie in Jaffa wird, deren Stolz nicht allein nur in den köstlichen Früchten ihres Orangenhains zu finden ist. Nach der Umsiedlung ins Westjordanland widmet sich die Geschichte auch der nächsten und schließlich übernächsten Generation und ihren traumatischen Schlüsselerlebnissen in der Folge von Nakba (Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung 1948) und Intifada.
Als Teenager Noor in den 1980er Jahren bei einer Demonstration verletzt wird, begleiten ihn seine Eltern in ein israelisches Krankenhaus in Haifa, wo unerwartet neben dem bisher im Mittelpunkt stehenden politischen Thema und der Geschichte vom Leiden eines Volkes noch ein weiteres komplexes, in der Gesellschaft kontrovers diskutiertes Thema zur Sprache kommt, bei dem sich Vater und Mutter anfangs noch nicht einig sind. Um was es da geht, soll hier nicht verraten werden. Nur so viel: es geht um eine Entscheidung, die nicht nur der eigenen, vom Schicksal schwer getroffenen Familie Hoffnung und Heilung geben kann, sondern auch einen Weg zur Versöhnung verspricht.

Lolita lesen in Teheran
Lolita lesen in Teheran
Italien/Israel.
Originaltitel: Reading Lolita in Teheran.
108 Minuten.
Regie: Eran Riklis.
Mit: Golshifteh Farahani, Zar Amir Ebrahimi, Mina Kavani, Reza Diako, Lara Wolf u. a.
Start: 20. November 2025.
Der „Große Gatsby“ auf der Anklagebank
Als Azar Nafisi 1979 nach dem Ende der islamischen Revolution mit ihrem als Architekt tätigem Ehemann in ihre vermeintlich wieder freie Heimatstadt Teheran zurückmigriert, lässt der Anblick von Henry James‘ Roman Daisy Miller den Grenzbeamten bereits kritisch die Stirn runzeln. Wenig später sind es vor allem männliche Studierende, die mit der komplexen und komplizierten Liebe von F. Scott Fitzgeralds Romanfigur Jay Gatsby und dessen kapitalistisch unmoralischem, materialistischem Auftreten ein Problem haben. So kommt’s, dass Nafisi wenig später den Roman im Zeugenstand vor Gericht verteidigen muss. Als ihr literaturwissenschaftliches Institut schließen muss, verlagern sich Diskussionsrunden über Werke der westlichen Literatur ins Private zu ihr nachhause, wo sich eine Gruppe mutiger Frauen heimlich trifft, um verbotene westliche Literatur zu lesen – ein Akt der Selbstermächtigung, der die Frauen zum Reflektieren über Freiheit, Liebe und Identität inspiriert.
Ähnlich wie schon in Nafisis Buchvorlage hat auch der israelische Regisseur Eran Riklis seinen Film in nach Romantiteln und -figuren benannte Kapitel unterteilt. Während eines Gesprächs zwischen Nafisi und ihrem literarisch-philosophischen Mentor lässt Riklis kurzzeitig eine vorrevolutionäre Szenerie entstehen, in der Frauen noch ohne Kopftücher in Straßencafés sitzen und sich spannende Lektüre im gutsortierten Buchladen kaufen konnten.

The Secret Agent
Brasilien 2025.
Originaltitel: O Agente Secreto.
158 Minuten.
Regie: Kleber Mendonça Filho.
Mit: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Udo Kier, Alice Carvalho u. a.
Start: 6. November 2025
Von Menschen und Haien
Ganz wohl ist es dem während des brasilianischen Karnevals in einem knallgelben VW-Käfer von São Paulo in die Küstenstadt Recife fahrenden Marcelo nicht, als er einen Tankstopp im Nirgendwo hat. Beunruhigend ist weniger die mit Pappe abgedeckte Leiche eines Mannes, die dort offenbar schon mehrere Tage zu liegen scheint, als die beiden Polizisten, die sich weniger für den Toten als für die Identität des Heimkehrers interessieren. Misstrauen jedenfalls steht in jenen Jahren auf der Tagesordnung.
Was als persönliche Reise aus dem Wunsch heraus, seinen kleinen Sohn zu sehen, beginnt, entwickelt sich bald zu einem gefährlichen Spiel im Schatten der Militärdiktatur. Angekommen in Recife nimmt Marcelo Kontakt zu einer Community auf, die Flüchtige, darunter auch aus Angola, vor dem Regime versteckt und sie mit neuen Pässen ausstattet. Viele von ihnen leben bereits unter Decknamen.
Dass dieser Paranoia-Thriller nach mehr als der Hälfte plötzlich in die Gegenwart springt und zwei Studentinnen zeigt, die in Gesprächsprotokollen auf Kassetten ein Bild dieser hitzigen Periode machen, gehört ebenso zu den Kniffen der Regie wie die wiederholte Erwähnung des Films Der weiße Hai, wobei in der Forensik einer Polizeistation ein getöteter Hai mit einem Menschenbein im Magen für leichtes Gruseln sorgt und im TV ein gefesselter Zeichentrickheld Popeye über einem gefräßigen Killerfisch baumelt. Unmissverständlich zum Ausdruck kommt auch, dass bis hinauf in oberste Polizeikreise menschliche Haifische schwimmen.
Kleber Mendonça Filho ist ein grandioser und bis zuletzt spannender brasilianischer Genrefilm gelungen. In Cannes wurde O agente secreto mit vier Preisen ausgezeichnet, darunter für die beste Regie und Wagner Moura als bestem Darsteller.

Solidarity
Deutschland/Schweiz 2025 (Dokumentarfilm)
90 Minuten
Regie: David Bernet
Mit: Marta Siciarek, Christine Goyer, Gillian Triggs, Filippo Grandi, Bashshar Haydar u. v. m.
Start: 25. September 2025
Farbfilm Verleih
Ein schmaler Grat zwischen Verbindung und Spaltung
Die Protagonist*innen seiner Recherche hat Bernet in Organisationen gefunden, die auf verschiedenen Ebenen Solidararbeit leisten. Die in Danzig lebende Polin Marta Siciarek etwa engagiert sich an der Grenze zu Belarus dafür, dass an auf der Flucht ums Leben gekommene Migrant*innen mit einem Grabmal erinnert wird. Zusätzliche Brisanz erfährt der Film durch den während der Dreharbeiten ausgebrochenen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Mit Mitarbeitenden des Internationalen Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) geht’s auch in Lager in der Bekaa-Ebene im Libanon, ein Philosoph in Beirut spricht über den Aspekt der Verbindung und weshalb die einen sich mit einer Sache solidarisieren oder sich von ihr abwenden.
„Es ist schwer vorstellbar, dass angesichts der neuen Brachialität autoritärer Bewegungen und der opportunistischen Aneignung dieser Brachialität auch durch demokratische Parteien die Welt heute in der Lage wäre, so etwas wie universelle Menschenrechte zu erfinden. Umso wichtiger ist es, uns zu vergegenwärtigen, was die Basis der Menschenrechte ist: Ein einzigartiges Verständnis für ‚globale Solidarität‘, für alle Menschen in Not, eine Solidarität, die über die Grenzen der Familie, der Gemeinschaft, der Kultur oder Nation hinausreicht und die nur existiert, wenn man sie wählt“, hält Regisseur Bernet fest. Denkanstöße zum interkulturellen Zusammenleben aufgrund von Migration gibt diese Doku.

Das tiefste Blau
Brasilien, Mexiko, Niederlande 2025 Originaltitel: O Último Azul
85 Minuten
Regie: Gabriel Mascaro
Mit: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás, Adanilo u. a.
Start: 25. September 2025
Verleih: Alamode Film
© Guillermo Garza Desvia (Alamode Film)
Abgeschoben mit Auszeichnung
Tereza, eine rüstige Frau von 77 Jahren, wird eines Tages überrumpelt von der Nachricht, dass die Zwangsverlegung in ein solches Lager nicht erst mit Erreichen des 80. Lebensjahres beginnt, sondern neuerdings schon mit 75. Behördenmitarbeitende überbringen ihr aus diesem Grund eine Auszeichnungsurkunde, ihr Firmenchef zahlt ihr den letzten Lohn aus. Wer bei Ausweiskontrollen die Altersgrenze überschritten hat, landet unter Umständen wie ein*e Verbrecher*in im Käfigwagen.
Tereza will diese Verordnung nicht hinnehmen. Noch hat sie, die sich ein Leben lang mit zwei Jobs über Wasser hielt, Träume, denen sie folgen möchte. Also macht sie sich auf, lässt sich von einem kauzigen Schmuggler auf dem Amazonas begleiten – und hat auf dieser Reise so einige ungewöhnliche Begegnungen. So wohnt sie zum Beispiel Spektakeln bei, bei denen exotische Fische ähnlich Hahnenkämpfen für Sportwetten herhalten müssen.
Dem Regisseur geht es mit seiner in keiner Phase düsteren, sondern vornehmlich heiter und entspannt sich entspinnenden Dystopie nicht um eine Systemkritik, sondern um eine feinhumorige Allegorie auf das Leben im Alter, gleichsam den Wunsch nach Freiheit und Widerstandsfähigkeit. Anspielungen auf Altersdiskriminierung und das Agieren autoritärer Strukturen finden sich nur unterschwellig.
Die in ihrer brasilianischen Heimat bekannte Darstellerin Denise Weinberg überzeugt mit einer lebenslustigen und geerdeten Performance. Freuen darf man sich insbesondere auch über eine Fülle magischer Bilder aus Ecken Brasiliens, die zeigen, wie wichtig es ist, die dortige Natur zu bewahren.

Briefe aus der Wilcza
Polen/Deutschland 2025
(Dokumentarfilm)
Originaltitel: Letters from Wolf Street
97 Minuten
Regie: Arjun Talwar
Mit: Piotr Chadryś, Mo Tan, Feras Daboul, Barbara Goettgens, Oskar Paczkowski u. v. m.
Start: 16. Oktober 2025
Verleih: Barnsteiner Film
Fotos: © Barnsteiner Film
Den Nachbarn auf den Zahn gefühlt
Die Straße, in der er wohnt, bietet ihm bereits eine Fülle an Begegnungen. Er besucht eine Feier anlässlich des Unabhängigkeitstages, schwenkt dabei auch probeweise die polnische Flagge. Er findet mit Graffities besprühte Wände, die „Polen für die Polen“ fordern, begegnet aber auch Bürger*innen, die Verständnis haben für Migrationsbewegungen („Wir wandern ja auch in andere Länder aus, um dort zu arbeiten“). Zugleich dokumentiert er, wie sich sein Viertel, in dem quasi in jedem Hinterhof eine eigene Heiligenfigur zu stehen scheint, im Zuge der Gentrifizierung verändert.
Talwar befragt dabei immer wieder auch sich selbst, versucht zu verstehen, warum sein indischer Freund an der polnischen Diaspora verzweifelt ist und sich das Leben nahm. „Hier Ausländer zu sein fühlt sich an wie ein Abenteuer“, sagt Talwar. Dass ihn ein Roma, den er am Rande einer CSD-Parade trifft (und nichts ahnend vom bunten Spektakel auf einen Bus gewartet hatte), zum „Familienmitglied“ erklärt, verblüfft den Filmemacher. Eine nette Freundschaft scheint sich da anzubahnen. Talwar recherchiert mit einer gesunden Mischung aus Humor und Melancholie und kommt am Ende zum Schluss, dass es doch spannend sein könnte, wenn auch an anderen Orten, an denen Einheimische und Migrant*innen zusammenleben, jede Straße jeweils eigene Chronist*innen hätte. Einfach mal auf die Nachbar*innen zugehen und sich für sie interessieren, würde schon viel zur Völkerverständigung in einer sich rasant verändernden Welt beitragen.

Bitter Gold
Chile, Mexiko, Uruguay, Deutschland 2024
Originaltitel: Oro Amargo, 83 Minuten
Regie: Juan Francisco Olea
Mit: Katalina Sánchez, Francisco Melo, Michael Silva, Daniel Antivilo, Moisés Angulo u. v. m.
Filmstart: 21. August 2025
jip film & verleih
Glückauf in einer gesperrten Mine
Früher wären sie vielleicht reitend auf dem Rücken eines Pferdes zur Arbeit erschienen. Bei Juan Francisco Olea kommt der (besoffene) Taglöhner mit dem Fahrrad zum Treffpunkt inmitten der weiten, sandigen und bergigen Atacama-Wüste im Norden Chiles. Auf der Ladefläche eines Pick-Up geht’s zur Mine. Die Arbeit ist hart, wird schlecht bezahlt. Die Laune hebt das nicht. Es scheint absehbar, dass der Taglöhner Stress machen wird. Als die 16-jährige Carola ihren Vater eines Nachts in eine gesperrte Mine, in der er Gold vermutet, begleitet, ahnen sie nicht, dass Troubleshooter Humberto ihnen folgt. Und zwar mit gravierenden Folgen. Vorübergehend muss Carola das Kommando für den väterlichen Arbeitstrupp übernehmen. Nicht leicht in einer Gesellschaft, in der Männer der Meinung sind, die Frau gehöre an den Herd. Tatsächlich aber ist genau dies zunächst Carolas Job, indem sie den Männern das Mittagessen zubereitet. Nachdem der Vater ausfällt, tun sich die Arbeiter schwer, Befehle und Arbeitsanweisungen von ihr anzunehmen. Und noch komplizierter wird es, als die Abwesenheit des Vaters und auch das Verschwinden von Humberto dauerhaft verheimlicht werden müssen und weitere unangenehme Zeitgenossen aufkreuzen.
Der tonangebende Konflikt dieses eine feministische Perspektive einnehmenden Dramas ist schnell gesetzt. Umso mehr lässt sich Regisseur Olea anschließend Zeit, den sich vor allem innerlich vollziehenden Kampf der jungen, sich gegen patriarchalische Strukturen und brutale Gesetze widersetzenden Frau und wie diese einen Schlüssel zur Selbstermächtigung für ein neues Leben findet, zu schildern. Die Ökumenische Jury des Filmfestivals von Warschau, bei dem Bitter Gol“ im Zuge seiner Weltpremiere 2024 einen Preis gewann, verglich die tiefgreifenden Veränderungen mit der Auferstehung Christi aus den Tiefen der Hölle hinab, um daraus gestärkt hervorzugehen. Weiter hieß es in der Begründung: „Manchmal können die schlimmsten Tragödien zu Chancen werden.“ Zur Atmosphäre des Films tragen neben der spannenden Dramaturgie auch Bilder großartiger Landschaften und ein moderner, von Electrosounds untermalter Score bei. Schön am Ende, dass im Angesicht des Unmöglichen die Hoffnung bleibt. Das Bild eines durch die Wüste fahrenden Motorrades bringt dies treffend zum Ausdruck.

Klandestin
Deutschland 2024, 124 Minuten
Regie: Angelina Maccarone
Mit: Barbara Sukowa, Lambert Wilson, Banafshe Hourmazdi, Habib Adda, Katharina Schüttler
Start: 24. April 2025
Verleih: Farbfilm
Klandestin
Vier Menschen, vier Biografien: in Angelina Maccarones zeit- und gesellschaftspolitischem Thriller Klandestin kreuzen sich ihre Wege, teils unfreiwillig, teils ungeplant. Im Kern geht es um eine Haltung zur Frage von Einwanderung und das Verfolgen von Lebensträumen. Maccarone hat ihren Film in Kapitel unterteilt, in denen die Erzählung jeweils die Perspektive von einer der vier Figuren einnimmt. Im ersten gelingt es dem jungen Marokkaner Malik (Habib Adda), sich im Lieferwagen des britischen Künstlers Richard (Lambert Wilson) zwischen Gemälden zu verstecken und unerkannt nach Frankfurt zu gelangen, wo Richard zu einer Ausstellung eingeladen ist. Mathilda (Barbara Sukowa), eine Freundin des Künstlers, lässt sich breitschlagen und gewährt Malik Unterschlupf, wissend, dass dies sie als gegen illegale Einwanderung eintretende Europa-Politikerin in Schwierigkeiten bringen könnte. Ihre junge Assistentin Amina (Banafshe Hourmazdi), in Deutschland als Kind marokkanischer Eingewanderter aufgewachsen, kommentiert das Versteckspiel immer wieder mit kritischen Blicken.
Mit zur Spannung trägt bei, dass Videokameras im städtischen Raum Bilder von Malik festhalten und ihn mit Personen zeigen, die im Verdacht stehen, einen Terroranschlag verantwortet zu haben. Dabei geht es ihm um nicht mehr als schnell nach Berlin zu gelangen, wo er sich als Rapper verwirklichen will. In den Medien wird der Anschlag derweil zum Anlass genommen, über die Arbeit von Frontex und die Wirksamkeit von Pushbacks an den Grenzen zu debattieren. In der Begegnung zwischen der konservativen Europaabgeordneten Mathilda und Malik treten neben der offenkundigen Symbolik „altes Europa versus arabischer Frühling“ auch Grautöne zutage.
Durch die Verschiebung der Blickwinkel werden Geheimnisse, die die Figuren voreinander haben, nach und nach enthüllt, ihre Sehnsüchte offenbart, Vorurteile gegeneinander ausgespielt und wie in einem Puzzle zu einem vielschichtigen Gesamtbild zusammengefügt. Letztlich sind alle vier in ihrer Einsamkeit und Entwurzelung untergründig verbundener als sie ahnen. Angelina Maccarone, Tochter eines Italieners und einer Deutschen, entwirft ganz nebenbei auch ein Bild einer gespaltenen Gesellschaft und einer globalisierten Welt, in der scheinbar unverbundene Schicksale auf komplexe Weise miteinander verwoben sind. Niemand kann sich entziehen, alle sind gefordert, Stellung zu beziehen.

Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne
(Originaltitel: Les Barbares)
Frankreich 2024, 101 Minuten
Regie: Julie Delpy
Mit: Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Zied Bakri, Jean-Charles Clichet, Rita Hayek, India Hair u.v.m.
Start: 26. Juni 2025
Verleih: Weltkino
Wählerische Gastgeber
Wer genau hinschaut, wird in Julie Delpys Culture-Clash-Komödie Die Barbaren –Willkommen in der Bretagne viele Figuren, Grabenkämpfe und Alltagssituationen erkennen, die typisch sind für Geschichten aus dem Gallierdorf von Asterix und Obelix. Bei Delpy sorgt nun die Ankunft einer syrischen Familie für ordentlich Aufregung unter den Bewohner*innen. Denn erwartet hätten sie viel lieber ukrainische Geflüchtete. Den Akt der gemeinschaftlichen Solidarität lässt nach Abstimmung durch den Gemeinderat der bretonischen Provinzgemeinde Paimpont der Bürgermeister bereits medienwirksam festhalten, selbst der nationalistisch eingestellte Klempner hat die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine abgenickt. Doch dann stellt sich heraus: es gibt wohl einen „Lieferengpass“, wie es heißt, seien die in Frankreich angekommenen Ukrainer*innen bereits verteilt auf andere Städte und Gemeinden. „Sie sind heiß begehrt auf dem Markt“, kommentiert dies der Bürgermeister mit einem verlegenen Schulterzucken – um nachzuschieben: „Zu uns kommt stattdessen nun eine syrische Familie.“
„Dafür haben wir nicht gestimmt“, melden sich prompt die ersten, betonen zugleich aber, grundsätzlich ja nichts gegen „Araber“ zu haben, wobei sich der Metzger sorgt, sie würden seine Wurst nicht kaufen. Andere stört bereits die Aussicht auf verschleierte Frauen, andere fürchten eine Invasion an Terroristen. Dass die Frauen der sechsköpfigen Familie Fayad keinen Schleier haben, ist dann aber ebenso verdächtig. Französisch haben sie bereits im Aufnahmelager ganz gut gelernt, kennen aus Damaskus sogar noch die Chansons von Dalida. Ihre Integrationswilligkeit wird zunächst komplett ignoriert.
Julie Delpy, die nicht nur Regie führte und auch am Drehbuch mitwirkte, spielt eine Lehrerin, die klar auf Seiten der Neuankömmlinge steht. Andere Figuren sind da wankelmütiger, was teils zu unterhaltsamen Konflikten untereinander führt, gleichzeitig deren menschliche Schwächen wie Vorurteile und fehlende Toleranz entlarvt. Auch was die syrische Familie an Traumata erlebt hat, wird angeschnitten. Delpy verliert dabei nie die Empathie für ihre Protagonist*innen, weshalb die satirisch überzeichneten Klischees zugleich als kritische Reflexion verstanden werden können. Aufgeteilt ist die Komödie in fünf Akte, die jeweils mit der Abbildung historischer Unterdrückungs- und Befreiungsszenen aus der reichhaltigen französischen Kolonialgeschichte beginnen. In Summe liefert der Film ein ebenso unterhaltsames wie überzeugendes Plädoyer für Menschlichkeit und ein friedliches Zusammenleben.

Quiet Life
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Schweden 2024, 100 Minuten
Regie: Alexandros Avranas
Mit: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro Chulpan Khamatova, Grigory Dobrygin, Naomi Lamp u. a.
Start: 24. April 2025
Verleih: von Wild Bunch
Quiet Life erhielt 2024 den Publikumspreis bei den 66. Nordischen Filmtagen und wurde beim Geneva International Film Festival mit dem Future Is Sensible-Award ausgezeichnet.
Quiet Life
Gut hat sie sich integriert in ihrem neuen Zuhause in Schweden, die russische Familie in Alexandros Avranas Einwandererdrama Quiet Life. Dann jedoch wird ihr Asylantrag abgelehnt – und die jüngste Tochter fällt in ein rätselhaftes Koma. Dieses wird als „Resignationssyndrom“ diagnostiziert, eine Krankheit, die in Schweden offiziell anerkannt ist. Zuckerbrot und Peitsche: zunächst sind die Behörden voll des Lobes, als sie die Eltern Sergei und Natalia sowie ihre Töchter in deren vier Wänden besuchen. Die Kinder kommen in der Schule, im Chor und beim Sport gut mit, sind sprachlich voll angekommen, sogar über schwedische Vornamen machen sie sich schon Gedanken. Zur endgültigen Bewilligung der Asylanträge aber fehlen dem Migrationsamt noch Beweise, dass Vater Sergei seinem Herkunftsland tatsächlich aufgrund politischer Verfolgung und psychischer Drangsalierung den Rücken gekehrt hat. Seine Narbe am Oberkörper ebenso wie die mündlichen Aussagen reichen nicht, in Verhören werden die Familienmitglieder in die Mangel genommen. Die Jüngste nimmt das Prozedere und die Aussicht, ausgewiesen und abgeschoben zu werden, besonders mit: Sie fällt ich ins Koma.
Dieses Krankheitsbild ist der Ausgangspunkt dieses kühl und distanziert,
ja fast klinisch gehaltenen Migrationsdramas. Als Resignationssyndrom wurde es diagnostiziert und gilt seit 2014 in Schweden tatsächlich als anerkannte, auch als „Dornröschenschlaf“ bezeichnete Krankheit, von der seit Beginn der 2000er-Jahre Hunderte an Flüchtlingskindern betroffen waren.
Das rätselhafte Symptom trat vornehmlich bei Kindern aus dem Kosovo, aus Serbien, Aserbaidschan, Kasachstan und Kirgistan auf.
Im Spielfilm des Griechen Alexandros Avranas verkompliziert sich die Lage für die russische Familie derart, dass ihr zeitweise sogar die Besuchsrechte im Krankenhaus entzogen werden. Geradezu absurd mutet an, wie psychotherapeutisch versucht wird, den in ihrer Situation gefangenen Eltern wieder ein Lächeln beizubringen.
Die kühle Ausstattung des Films passt dabei gut zum Ohnmachtscharakter der Geschichte, die wachsende Verzweiflung äußert sich bei den Darsteller*innen in leisen Gesten und einer Mimik, die gerade durch ihre kontrollierte Zurückhaltung fasziniert – und eben dadurch ihre Wirkung nicht verfehlt.